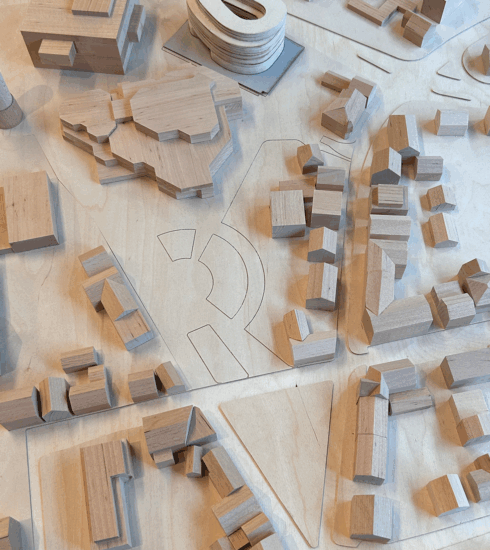Mentale Stärke
Das Leben verläuft selten nach Plan. Manchmal verändert ein einziger Moment alles – ein Unfall, eine Diagnose, der Verlust eines geliebten Menschen oder die Geburt eines Kindes mit Behinderung. Plötzlich steht die Welt still, und nichts ist mehr, wie es war. In solchen Momenten entscheidet sich, wie wir weitergehen: Brechen wir zusammen – oder finden wir neue Stärke?
Dr. Leon Windscheid, Psychologe und Bestsellerautor, bekannt aus der ZDF-Sendung Terra Xplore und zusammen mit Atze Schröder Co-Host vom Podcast Betreutes Fühlen, erforscht, was Menschen trägt, wenn das Leben sie an ihre Grenzen bringt. Die Gütersloherin Anuschka Bayer spricht mit dem bekannten Psychologen über mentale Stärke, Überforderung, tiefe Trauer – und darüber, warum wir manchmal funktionieren, obwohl wir innerlich längst erschöpft sind.
Wenn das Leben plötzlich anders kommt – ein Unfall, ein behindertes Kind, der Verlust eines Kindes – was hilft uns, seelisch nicht zu zerbrechen? Wie kann mentale Stärke entstehen, wenn der Schmerz kaum auszuhalten ist?
Was sich immer wieder zeigt ist, dass sozialer Zusammenhalt ein unheimliches Schutzschild ist und in Momenten der größten Krisen den Menschen ganz viel Kraft geben kann. Das bedeutet: Habe ich eine beste Freundin, die mich anruft, habe ich Eltern, die mir beistehen, habe ich einen Freundeskreis, der da ist und mich unterstützt, habe ich einen Partner oder Partnerin an meiner Seite, bei dem oder der ich merke, dass ich nicht alleine bin und unterstützt werde? Der Mensch ist ein hypersoziales Wesen, das heißt, wir leben nicht nur im sozialen Verbund, wir leben sogar davon, dass wir sozial verbunden sind. Es bedeutet, wenn es richtig schwierig wird, ist das etwas, das unserer Psyche einen richtigen Boost geben kann. Und ein zweiter wichtiger Punkt: Viele Menschen denken, dass man an einer schweren Krise zerbricht. Ich kenne aber die Forschung von Professor George A. Bonanno, der sich sehr viel mit Resilienz beschäftigt und zeigen kann, dass in dem Moment, in dem zum Beispiel Eltern ihr Kind verlieren, Narben bleiben, dass da ganz viel Schmerz und Traurigkeit ist, und trotzdem ist es so, dass die allermeisten an solchen schweren Schicksalsschlägen nicht zerbrechen. Sie schaffen es, weiter durch ihr Leben zu gehen. Natürlich mit Traurigkeit und mit mentalen Wunden, aber ohne kaputtzugehen. Und das ist auch etwas, was Hoffnung macht – der Mensch ist ein unglaublich zähes Wesen.
Viele Eltern mit schwer kranken Kindern funktionieren im Alltag weiter – oft bewundernswert, aber innerlich erschöpft. Du sprichst von „hochfunktionaler Depression“. Was steckt dahinter?
„Hochfunktionale Depression“ ist keine offizielle Diagnose und dennoch ein Begriff, der vielen Leuten hilft, weil sie merken, dass er genau das beschreibt, was sie erleben. Man liefert nach außen Leistung, man funktioniert vielleicht im Job, vielleicht sogar besonders gut, obwohl es in einem drin ganz anders aussieht, man niedergeschlagen ist, alles düster erscheint, man mit der Depression kämpft. Das ist ein Begriff, bei dem es sich lohnt, ihn zu kennen. Gleichzeitig muss uns aber auch bewusst sein: Eine Depression, auch wenn sie viele Gesichter haben kann, ist eine Depression. Wir leben eh schon in einer Leistungsgesellschaft, wo es ganz oft darum geht, dass man dann eher einen Schein nach außen wahrt. Dann sagt man lieber, man hat Burn-Out, statt psychische Probleme. Obwohl hinter einem Burn-Out auch am Ende oft eine Depression steckt. Soll heißen, diese Begrifflichkeiten haben zwei Gesichter. Es ist wichtig zu erkennen, dass es Menschen gibt, die nach außen hin perfekt wirken, obwohl es ihnen psychisch gar nicht gut geht. Aber Vorsicht, wenn wir jetzt für jeden einzelnen Zustand einen neuen psychologischen Begriff einführen, dann blickt am Ende keiner mehr durch – und damit ist auch niemandem geholfen.
Wie erkennt man, dass man nicht mehr nur stark ist, sondern eigentlich am Limit lebt?
Wenn man seinen eigenen Alltag nicht mehr so bestreiten kann, wie man es von sich gewohnt ist, wenn Bewältigungs-, Copingstrategien nicht mehr greifen, wenn man merkt, dass man sich sozial zurückzieht, an den Sachen, die einem früher mal Spaß gemacht haben, keine Freude mehr findet, dann sind das klare Indizien. Ich sage immer: Lass es doch lieber einmal zu viel abchecken als einmal zu wenig. Es gibt in Deutschland mittlerweile die „Psychotherapeutische Sprechstunde“, die ich für eine gute Einrichtung halte. Zwar beginnt man dort keine direkte Therapie, aber sie ist sehr niedrigschwellig und kurzfristig zugänglich. So kann man mit einem Profi, also mit einer psychologischen Psychotherapeut*in sprechen, die einem sagen kann, was ist oder ob eben nichts ist. Also liebe Leute, stark sein ist super, es ist aber keine Schwäche, sich Hilfe zu holen.
Warum fällt es uns so schwer, Hilfe anzunehmen oder offen zu sagen, dass es uns schlecht geht – besonders in einer Gesellschaft, die Perfektion und Stärke so hochhält?
Wenn von außen gefordert wird, dass man stark sein muss oder man mit Sprüchen großgeworden ist wie: „Du musst hart sein wie Kruppstahl“, „Du darfst keine Schwäche zeigen“ oder dieser – auf allen Ebenen – schreckliche Spruch: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“, dann muss man sich nicht wundern, wenn das allgemeines Mindset ist. In dem Moment, wo ich Schwäche zeige, erfülle ich die Anforderungen nicht, was wiederrum Stress auslöst, und dann verstecke ich das lieber und tue so, als wäre ich stark.
Rund jeder vierte Deutsche erfüllt einmal im Jahr die Kriterien einer psychischen Störung, aber von denen ist nur jeder fünfte bereit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich kann verstehen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht alles psychologisieren. Es ist auch nicht alles direkt eine psychische Störung oder ein psychisches Problem, aber wer jetzt daraus schließt, dass die Leute sich zu sehr anstellen, liegt falsch. Es gibt immer noch sehr viel mehr Menschen, die vorgeben, es gehe ihnen gut, als solche, die so tun, als wären sie psychisch krank.
Welche Wege führen aus dieser emotionalen Dauerbelastung heraus?
Wie kann man wieder Kraft schöpfen, ohne sich selbst zu verlieren?
Bitte sprecht, macht auf, traut euch, euch jemandem anzuvertrauen. Das ist häufig der erste Schritt. Sprecht mit einer guten Freundin oder einer Vertrauensperson, auch bitte nicht davor zurückschrecken, die 112 zu wählen, wenn es akut ist. Da wissen dann Profis, was jetzt die nächsten Schritte sein können. Ich habe schon so oft erlebt, dass Betroffene in einer akuten Situation so eine Scham hatten, die wir nicht hätten, wenn wir uns den Knöchel verstauchen. Dann ist es ein weiterer Schritt, sich eventuell um eine Behandlung zu kümmern, sich auszutauschen – wie schon erwähnt. Dann natürlich „Psycho-Hygiene“ zu betreiben, dazu gehören Schlaf, Ernährung und Bewegung, also Kleinigkeiten, die aber einen Beitrag zu unserer psychischen Gesundheit leisten können.
Und wenn das Schicksal bleibt – das kranke Kind, der Verlust, die Sorge – wie kann man trotzdem Momente von Zufriedenheit und Lebensfreude finden?
Was bedeutet für dich „echte Stärke“ in solchen Situationen?
Für mich bedeutet echte Stärke in solchen Momenten, dass man beides zulässt. Es gibt das „Duale Prozessmodell der Trauer“, was im ersten Moment kompliziert klingt, aber eigentlich nur beschreibt, dass da zwei Gesichter sind. Das eine ist voller Traurigkeit – und da steht der Verlust im Vordergrund. Es sind die Momente in denen man sich einsam und niedergeschlagen fühlt und verzweifelt. Und dann ist da auch ein anderes Gesicht, das sich zum Beispiel an den Erinnerungen erfreut, mal wieder auf eine Party zu gehen. Ein Gesicht, das vielleicht die Sonnenstrahlen genießt, das sich vielleicht freut, wenn es nach Hause kommt und nach einem Kuchen riecht, den der Partner gebacken hat. Also, nicht denken, weil etwas Schlimmes passiert ist, muss ich in so ein Korsett der Traurigkeit hinein und darf keine Momente haben, in denen es mir auch mal gut geht.
Lieber Leon, vielen Dank für dieses offene Gespräch. Du erinnerst uns daran, dass mentale Stärke nicht bedeutet, immer stark zu sein – sondern sich selbst zu erlauben, schwach zu sein, zu fühlen und trotzdem weiterzugehen. Dass wir Menschen nicht scheitern, wenn wir zweifeln, sondern wachsen, wenn wir lernen, das Unperfekte zu akzeptieren. Und dass vielleicht genau dann „alles perfekt“ ist, wenn wir verstehen, dass es das nie sein muss.
Foto: Jonathan Welzl